Einstieg
Internationale Zusammenarbeit der Schweiz – Jahresbericht 2024
Why Care?
Grundversorgung
Leben retten und Grundversorgung stärken
Leben retten und Grundversorgung stärken
Wirtschaft
Wie kann Wirtschaftswachstum nachhaltiger werden?
Wie kann Wirtschaftswachstum nachhaltiger werden?
Frieden
Warum brauchen wir Gerechtigkeit?
Umwelt
Das Klima und natürliche Ressourcen schützen
Das Klima und natürliche Ressourcen schützen
Krisen
Kriege, Krisen und Konflikte
Statistik
Statistik 2024Das Wichtigste in Kürze
IZA Strategie
Strategie zur internationalen Zusammenarbeit (IZA)
Strategie zur internationalen Zusammenarbeit (IZA)
Bilaterale Ausgaben nach Region
Das SECO ist insbesondere in Ländern mit mittlerem Einkommen tätig. Die Zusammenarbeit mit den Ländern der Region Europa machte 2024 über ein Drittel der bilateralen Ausgaben aus.
Bilaterale Ausgaben nach Themen und Zielen
Ausgaben der DEZA nach Sektor
Ausgaben des SECO nach Sektor
Ausgaben der DEZA nach Region und Sektor
Ausgaben des SECO nach Region und Sektor
Klima
Gouvernanz
Gender
Aufteilung und Entwicklung der Ausgaben der DEZA
Zwischen 2016 und 2019 wirkten sich die Sparmassnahmen auf die internationale Zusammenarbeit aus.
Die Zunahme der Ausgaben von 2020 bis 2023 ist hauptsächlich auf die vom Parlament bewilligten Zusatzkredite zurückzuführen, namentlich als Beitrag an die internationalen Bemühungen zur Linderung der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und als Reaktion auf die humanitäre Krise in Afghanistan, den Krieg in der Ukraine und den Konflikt im Nahen Osten. Der Rückgang im Jahr 2024 ist auf die Kürzung der Mittel für die internationale Zusammenarbeit zurückzuführen.
Aufteilung und Entwicklung der Ausgaben des SECO
Zwischen 2016 und 2019 nahmen die Mittel infolge der Sparmassnahmen des Bundes ab.
Der Anstieg in den Jahren 2022 und 2023 ist insbesondere auf die genehmigten Zusatzkredite im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine zurückzuführen.
Europa
Naher und Mittlerer Osten
Afrika
Asien
Lateinamerika
Europa
Seit Beginn der militärischen Aggression Russlands hat die Schweiz ihre Unterstützung für die Ukraine deutlich erhöht und setzt sich für die vom Konflikt betroffene Bevölkerung ein.
Naher und Mittlerer Osten
Afrika
Die humanitäre Hilfe führt Programme am Horn von Afrika, in der Sahelzone, in Zentralafrika und im südlichen Afrika durch. Sie ist in folgenden Bereichen tätig: Stärkung der Widerstandsfähigkeit gegen die Auswirkungen der Trockenheit, Schutz der Zivilbevölkerung in bewaffneten Konflikten, Ernährungssicherheit, Zugang zu Wasser und Siedlungshygiene.
In Nordafrika will die Schweiz mit ihrem Engagement zu mehr Inklusion, Wohlstand und Frieden beitragen.
Asien
Die Aktivitäten der DEZA in Ost- und Südasien konzentrieren sich auf Länder und Regionen, in denen die multidimensionale Armut nach wie vor hoch ist, insbesondere in Bezug auf Einkommen, Sicherheit und Zugang zur Grundversorgung.
Die wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit des SECO unterstützt Vietnam auf seinem Weg zu nachhaltigem und marktorientiertem Wachstum. Die Aktivitäten in Indonesien tragen dazu bei, die Herausforderungen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung zu bewältigen und die Wirtschaft des Landes wettbewerbsfähiger, resilienter, gerechter und ressourceneffizienter zu machen.
Lateinamerika
In Peru unterstützt das SECO vor allem den Aufbau von wirtschaftlichen Institutionen, einen wettbewerbsfähigen Privatsektor und den Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen. In Kolumbien, wo Teile des Landes nach wie vor stark unter dem Einfluss bewaffneter Gruppen und der organisierten Kriminalität stehen, schafft das SECO wirtschaftliche Perspektiven und leistet dadurch einen Beitrag zu einem nachhaltigen Frieden.
Öffentliche Entwicklungshilfe (APD) der Schweiz
Die APD der Schweiz im internationalen Vergleich 2024
In Bezug auf das Finanzvolumen sind die USA, Deutschland, Grossbritannien, Japan und Frankreich die grössten Beitragszahler. In absoluten Zahlen belegt die Schweiz den 11. Platz.
Entwicklung der APD/BNE-Quote der Schweiz von 2015–2024
Aufgrund der zusätzlichen Mittel für die Covid-19-Pandemie und die Krisen in Afghanistan, in der Ukraine und im Nahen Osten sowie aufgrund der gestiegenen Asylkosten stieg die APD zwischen 2020 und 2023 stark an.
Der Rückgang im Jahr 2024 ist auf die rückläufigen der APD anrechenbaren Asylkosten und die Kürzung der Mittel für die internationale Zusammenarbeit zurückzuführen.
Entwicklung der APD der Schweiz von 2015–2024
Entwicklung der multilateralen APD der Schweiz von 2015–2024
Die Beiträge an internationale Nichtregierungsorganisationen, einschliesslich des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, gelten als bilaterale (und nicht als multilaterale) APD.
Die Schweiz engagiert sich in der Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
Weiterführende Informationen:
EITI Progress Report 2024 (PDF) (en)
Sudan: Eine Krise fernab der Öffentlichkeit
- Mehr als 15 Millionen Menschen sind auf der Flucht, darunter 3,9 Millionen Flüchtlinge in Nachbarländern wie dem Tschad, dem Südsudan und Ägypten.
- Fast 25 Millionen Menschen – 50 % der Bevölkerung – leiden unter akuter Ernährungsunsicherheit, in mehreren Regionen herrscht Hungersnot.
- 30 Millionen Menschen benötigen humanitäre Hilfe.
Seit November 2024 werden die operativen Aktivitäten von der Schweizer Botschaft in Kairo koordiniert, um die Lage vor Ort besser verfolgen und schneller auf Veränderungen reagieren zu können.
Konkrete Fortschritte wurden erzielt:
- Öffnung humanitärer Übergangsstellen aus dem Tschad.
- Genehmigung humanitärer Flüge.
- Verabschiedung verstärkter Massnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung.
Weiterführende Informationen DEZA:
Sudan
Zwei Jahre Krise im Sudan: Unterstützung ist wichtiger denn je
Damit Geburt und Entbindung nicht länger mit Gefahr verbunden sind
Das Gesundheitssystem ist jedoch mangelhaft: Die sanitären Einrichtungen sind unzureichend und unangemessen, der Zugang zu medizinischer Versorgung ist eingeschränkt und es fehlt dringend an qualifizierten Arbeitskräften.
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat die Schweiz im November 2024 ein neues Projekt lanciert, das die Sterblichkeitsrate von Müttern und Kindern unter fünf Jahren senken und Epidemien bekämpfen soll. Das mit 11,9 Millionen Franken finanzierte Programm soll mehr als 8 Millionen Menschen zugutekommen.
Die DR Kongo ist immer wieder von Epidemien (Cholera, Masern, Malaria, Ebola) betroffen. Mit mehr als 18'000 bestätigten Fällen und über 1'700 Todesfällen zwischen Januar 2024 und März 2025 ist die DR Kongo das am stärksten vom Mpox-Virus betroffene Land. Mit diesem Projekt unterstützt die Schweiz die Bekämpfung des Virus durch verstärkte Überwachung, Förderung eines gesunden Lebenswandels und die Bereitstellung von medizinischen Kits.
Weiterführende Informationen:
Webseite Bund: Die Schweiz lanciert ein Projekt zur Senkung der Mütter- und Kindersterblichkeit in der DRK
Webseite EDA: Humanitäre Krise in der Demokratischen Republik Kongo: die Schweiz stellt drei Millionen Franken bereit
Humanitäre Hilfe: Mittlerer und Naher Osten
- 69 Millionen Franken in zwei Tranchen für Organisationen aus der Schweiz, das IKRK, UNO-Organisationen sowie internationale und vereinzelt lokale NGO.
- 10 Millionen Franken an den humanitären Hilfsappell der UNRWA für die dringendsten Bedürfnisse im Gazastreifen.
2024 setzte die Schweiz ihre Reaktion auf die Syrienkrise mit ihrer Präsenz in Jordanien, der Türkei und dem Libanon sowie über ihr humanitäres Büro in Damaskus fort.
Das humanitäre Büro in Damaskus hat seine Aktivitäten fortgesetzt. Die DEZA hat zusammen mit einem Konsortium aus vier internationalen NGOs und fünf UNO-Organisationen ein «Early Recovery»-Programm gestartet. Es deckt die Bedürfnisse der syrischen Bevölkerung in den Bereichen Einkommen, Lebensunterhalt, Unterkunft, Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene.
Weiterführende Informationen:
Webseite EDA: Die Lage im Nahen Osten
Gemeinsam für einen nachhaltigen Kaffeesektor
• Wirtschaftlich: Bauernfamilien sollen ein existenzsicherndes Einkommen erwirtschaften können.
• Sozial: Die Kaffeeindustrie soll Produzentinnen und Produzenten faire Arbeitsbedingungen sowie Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung gewährleisten und Risiken für Menschenrechtsverletzungen beseitigen.
• Ökologisch: Die Kaffeebranche soll Wälder schützen, bzw. diese wiederaufforsten und Netto-Null-Emissionen verursachen.
Weiterführende Informationen:
Webseite: Schweizer Plattform für nachhaltigen Kaffee
Kein Frieden ohne psychische Gesundheit
Orest Suvalo
Psychiater und Leiter
Mental Health for Ukraine
Weiterführende Informationen DEZA:
Psychische Gesundheit: ein vernachlässigter Bestandteil des Friedens
Psychische Gesundheit als Schlüssel für einen nachhaltigen Frieden
Eine Renaissance für den honduranischen Kakao
«Das nationale Komitee hat wesentlich dazu beigetragen, die Arbeit zu koordinieren und die Gouvernanz des Kakaosektors zu verbessern», sagt Walter Reithebuch, Vertreter der DEZA in Honduras. «Diese Fortschritte konnten nicht zuletzt dank der Zusammenarbeit unter den verschiedenen Akteuren erzielt werden: Produzentinnen und Produzenten, Genossenschaften, Behörden und private Unternehmen wie Halba, einer der grössten Schokoladenhersteller der Schweiz.»
- Anbauflächen: Insgesamt 2775 Hektaren, davon 1545 Hektaren neue Anbaugebiete und 1230 Hektaren sanierte Kakaoplantagen.
- Kleinbäuerliche Betriebe: 2245 Bäuerinnen und Bauern profitierten vom Programm.
- Produktivität: Die Produktivität stieg von 130 auf 495 Kilogramm pro Hektare in flachen Gebieten. In Hanglagen wurden 310 Kilogramm pro Hektare erzielt.
- Exporte: Bis 2024 will Honduras mehr als 2000 Tonnen Kakao exportieren.
Herausforderungen bleiben bestehen, besonders Klimaphänomene und Infrastruktur. « Für das Wachstum ist es wichtig, in den Sektor zu investieren», sagt Melvin Fajardo.
Inklusion war ein weiterer Pfeiler des Programms. Ca. 42% der Führungspositionen wurden durch Frauen besetzt, 450 junge Menschen wurden bei unternehmerischen Vorhaben unterstützt. «Die Beteiligung von Frauen und Jugendlichen ist für die Nachhaltigkeit des Sektors unerlässlich», sagt Mariela García vom Ministerium für Landwirtschaft und Viehzucht.
Weiterführende Informationen:
Webseite HALBA: Nachhaltigkeit vom Anbau bis zum Genuss
Länderprogramm Ukraine
Die Schweiz hat beispielsweise mitgeholfen, in der Stadt Schytomyr ein lokales Fernwärmenetzwerk zu modernisieren. Ein neues, mit Holzschnitzel betriebenes Heizwerk ersetzt die alten, mit Gas gefeuerten Heizkessel.
Weiterführende Informationen:
Webseite EDA: Newsticker Ukraine
Webseite DEZA: Länderseite Ukraine
Webseite: Switzerland+Ukraine (en)
Ukrainische Unternehmen krisenresistenter machen
Infolge des Krieges ist für ukrainische KMU entscheidend, dass sie ihre Produkte auch exportieren können. Der alleinige Eintritt einer Firma in ausländische Märkte ist jedoch fast unmöglich. Darum unterstützt das UNDP-Projekt beispielsweise die ukrainische Vereinigung der Möbelhersteller, sich strategisch auf den Export auszurichten. Die Vereinigung hat die Marke Furniture of Ukraine geschaffen und sie international sichtbar gemacht. Sie schult und berät ihre Mitglieder, organisiert Messeauftritte im Ausland und hilft ihren Mitgliedern, sich auf europäischen Märkten zu positionieren. Bisheriges Ergebnis: über 50 neue Exportverträge für ukrainische Möbelhersteller, unter anderem mit IKEA und XXXLutz.
eine immer bedeutendere Rolle. Allerdings verhindern Ungleichheiten noch immer, dass Frauen gleichberechtigt am Wirtschaftsleben teilhaben können. Women in Business stellt unerfahrenen Geschäftsfrauen Mentorinnen zur Seite, die sie beraten und schulen und ihnen helfen, ein eigenes Unterstützungsnetzwerk aufzubauen.
Weiterführende Informationen SECO:
Ukraine
Die DEZA beschreitet in Lateinamerika neue Wege
Die Schweiz engagierte sich ab dem Jahr 2000 in der Zusammenarbeit mit Kuba. Mit Unterstützung der DEZA entstanden neue Ansätze in der lokalen Verwaltung und der ländlichen Entwicklung, die sogar Eingang in nationale Gesetze fanden. So erkannte die kubanische Verfassung von 2019 erstmals die kommunale Eigenständigkeit, die Rolle zivilgesellschaftlicher Akteure und direkte Mitwirkungsmöglichkeiten der Bevölkerung an. Auch die lokale Lebensmittelproduktion wurde gestärkt, ebenso wie der Aufbau von Organisationen im privaten Sektor – ein Novum für das Land.
Nach der politischen Krise 2004 und schweren Naturereignissen im Jahr 2005 startete die Schweiz ein humanitäres Programm in Haiti. In den Folgejahren wurde das Land immer wieder von schweren Naturereignissen erschüttert. Die DEZA unterstützte in der Folge den Bau von erdbebensicheren Schulen, Notunterkünften und Wohnhäusern. Sie entwickelte gemeinsam mit lokalen Partnern Bauweisen, Schulungen und Standards, die heute in Haitis Bauvorschriften verankert sind. Internationale Entwicklungsbanken orientieren sich inzwischen an diesen Schweizer Modellen, wenn sie soziale Infrastrukturprojekte im Land finanzieren.
Seit den 1980er Jahren förderte die DEZA in Bolivien die lokale Mitbestimmung. Durch Programme zur Dezentralisierung und Bürgerbeteiligung wurden benachteiligte Gruppen, vor allem indigene Gemeinschaften, stärker in politische Prozesse eingebunden – ein wichtiger Beitrag zur Demokratie in einer von Ungleichheit geprägten Gesellschaft. In den letzten zwei Jahrzehnten lag der Schwerpunkt zudem auf der Förderung der Landwirtschaft und der Einkommenssicherung für Kleinbauern. Gleichzeitig wurden Projekte umgesetzt, um die Widerstandskraft gegenüber dem Klimawandel zu erhöhen und die Regierungsführung verbessern.
In Nicaragua hat die Schweiz mit ihrer Unterstützung im Bereich Wasser und Abwasser viel zur Verbesserung der Lebensbedingungen beigetragen. In den letzten zwei Jahrzehnten standen der Zugang zu sauberem Wasser, sanitären Anlagen und der Schutz vor klimabedingten Naturereignissen im Mittelpunkt der Zusammenarbeit.
Besonders wirkungsvoll war der Ansatz der DEZA, wobei Projekte gemeinsam mit lokalen Gemeinschaften geplant und umgesetzt wurden. Dabei spielten Frauen und junge Menschen eine wichtige Rolle. Ihre aktive Beteiligung war entscheidend, um die Projekte langfristig abzusichern.
Seit 1981 war die Schweiz in Honduras aktiv. Mit lokalen Behörden und privaten Partnern unterstützte die DEZA den Anbau und die Vermarktung von Kakao, Kaffee und Garnelen. Zwischen 2013 und 2017 entstanden dadurch rund 30'000 neue Arbeitsplätze. Besonders der Kakao-Sektor erlebte in den vergangenen Jahren einen Aufschwung. Fair produzierte Schokolade aus Honduras hat einen Markt gefunden und liegt heute auch in den Regalen von Schweizer Supermärkten. Impulse setzte die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit auch im Bereich der guten Regierungsführung.
Seit 1997 hat die Schweiz in Peru Projekte zur Wasserversorgung und sanitären Grundversorgung in abgelegenen Bergregionen unterstützt. Neben dem Bau von Infrastrukturen setzte die DEZA auf Bürgerbeteiligung: Die lokalen Gemeinschaften wurden in die Verwaltung der Wassersysteme eingebunden, was deren Selbstständigkeit stärkte. Bis 2019 konnten so rund zwei Millionen Menschen direkt von den Programmen profitieren. Das gewonnene Fachwissen wurde auch in anderen Ländern Lateinamerikas angewendet – und kann künftig auch Regionen in Afrika und Asien zugutekommen.
Weiterführende Informationen:
Webseite DEZA: 60 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit
Webseite DEZA (en): Latin America and the Caribbean
Von Kambodscha bis zur Ukraine: Die Schweiz fördert Minenräumung weltweit für eine sichere Zukunft
- Prävention durch Aufklärung über Gefahren - das Räumen von Personenminen und anderen explosiven Kriegsmunitionsrückständen.
- Opferhilfe inklusive Rehabilitation sowie soziale und wirtschaftliche Wiedereingliederung von Überlebenden.
- Überzeugungsarbeit für die Ächtung von Personenminen und Streumunition.
Weiterführende Informationen
Webseite EDA: Schweizer Einsatz für die humanitäre Minenräumung 2024
Webseite EDA: Ukraine Mine Action Conference UMAC2024
Webseite DEZA: Sind die Minen weg, explodiert die Entwicklung
Mongolei: Rückblick auf eine 20-jährige Partnerschaft
Weiterführende Informationen:
Webseite DEZA (en): Best Practices from Mongolia
Grüne Revolution
Eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und der Mongolei ist ein entscheidender Faktor für die Erfolge, die erzielt wurden. Dank dieser Kooperation konnte eine Gesetzesänderung im Bereich Saatgut und Pflanzensorten umgesetzt werden. Dadurch wurde das Interesse der Wissenschaft an der Entwicklung neuer Gemüsesorten geweckt und private Investitionen in diesem Sektor gefördert.
Nach 20 Jahren erfolgreichem Engagement wird die Schweiz ihre bilaterale Entwicklungszusammenarbeit in der Mongolei bis Ende 2024 beenden. Sie stellt dabei einen verantwortungsvollen Ausstieg sicher und achtet darauf, dass die bisher erreichten Resultate bestehen bleiben. Zukünftige Partnerschaften und andere Formen von Unterstützung sind weiterhin möglich, beispielsweise in den Bereichen Klimawandel, humanitäre Hilfe, Politikentwicklung oder Handel.
Weiterführende Informationen:
DEZA-Webseite: Das grüne Gold: Die Lebensgrundlage in der Mongolei
DEZA-Webseite 20 Jahre Mongolei
Spotify DEZA Podcast "Das mongolische Kartoffel-Projekt"
Saubere Luft – für die Gesundheit und das Klima
Weiterführende Informationen:
DEZA-Webseite Luft zum Atmen in der Mongolei
DEZA-Newsletter Clean air fo all (en)
Wasserzusammenarbeit fördern: Blue Peace
Im Zentrum von Blue Peace steht die Erkenntnis, dass nachhaltige Lösungen kontextspezifisch sein müssen und über den Wassersektor hinaus Zusammenarbeit erfordern.
Blue Peace unterstützt hochrangige Politikdialoge, leistet technische Hilfe, fördert Forschung und digitale Werkzeuge für hydrometeorologische Dienste. Um Wasservorhersagen und Katastrophenvorsorge zu verbessern, wird der Austausch von Daten gefördert.
Wasser ist lebenswichtig für die rund 75 Mio. Menschen im Aralseebecken, geprägt von Amu Darya und Syr Darya.
Im Februar 2024 nahmen Tadschikistans und Usbekistans Energieminister gemeinsam zwei Pegelstationen an den Grossen und Nördlichen Ferghana-Kanälen in Betrieb – denn: «Was wir nicht messen, können wir nicht managen.»
Blue Peace-Finanzierung in Westafrika
Afrika verfügt über den grössten Anteil an grenzüberschreitenden Flusseinzugsgebieten und Aquiferen, doch der Klimawandel führt zu extremer Wasserknappheit. Durch Blue Peace-Finanzierungen wurden innovative Mechanismen entwickelt, um eine nachhaltige Wasserbewirtschaftung zu fördern.
In Zusammenarbeit mit der Gambia River Development Organization wurde der erste integrierte Entwicklungs-Masterplan erarbeitet – eine multisektorale Roadmap für Klimaresilienz, Frieden und Wohlstand, modellhaft für andere Flusseinzugsgebiete.
An der UN-Wasserkonferenz 2023 hob die Schweiz die Vorteile der Kooperation über gemeinsame Wasserressourcen hervor. Ihre politischen Bemühungen – insbesondere die Förderung und Finanzierung der grenzüberschreitenden Wasserzusammenarbeit – haben einen wichtigen Beitrag zur globalen Wasseragenda geleistet.
Weiterführende Informationen:
Webseite DEZA: Blue Peace beugt Konflikten vor und trägt zu mehr Stabilität bei
Webseite EDA: Leitlinien und Aktionspläne des EDA
IZA Strategie 2025-2028
Die DEZA schliesst ihre bilateralen Entwicklungsprogramme in Albanien, Bangladesch und Sambia bis Ende 2028. Gleichzeitig nimmt sie Anpassungen in den Bereichen Bildung und Gesundheit vor und kürzt ihre Beiträge an ausgewählte UNO-Organisationen.
Weiterführende Informationen:
Webseite DEZA: Strategie der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 2025-2028
Das Portal der Schweizer Regierung: Entwicklungszusammenarbeit: EDA und WBF setzen Parlamentsbeschlüsse
Mali: Wenn Frauen Frieden stiften
An ihrem IC Forum 2024 zum Thema Frieden widmete die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit eine Podiumsdiskussion der Sahelzone mit Schwerpunkt auf Mali. In diesem von jahrelangen Krisen geprägten Land waren Frauen nicht an den Gesprächen beteiligt, die zum Friedensabkommen von Algier 2015 führten.
Das Projekt steht in vollem Einklang mit der Resolution 1325 der Vereinten Nationen und dem nationalen Aktionsplan 1325 von Mali, die darauf abzielen, die Rechte der Frauen, ihren Schutz und ihre Beteiligung an der nationalen Versöhnung zu stärken.
Die Kreise helfen dabei, Traumata zu heilen, sich wieder aufzubauen, Konflikte friedlich zu lösen und stärken die Selbstständigkeit und Widerstandsfähigkeit. Sie tragen auch dazu bei, geschlechtsspezifischer Gewalt vorzubeugen, indem sie junge Frauen für ihre Rechte sensibilisieren und ein respektvolles Miteinander fördern, auch innerhalb der Familie.
«Es erfüllt mich mit grossem Stolz, dass Frauen aus den Friedenskreisen nun Positionen im Nationalen Übergangsrat bekleiden»
Bintou Founé Samaké
Direktorin von WILDAF/Mali und ehemalige Ministerin
Die Kreise gehen noch weiter: Frauen und Jugendliche entwickeln dort konkrete Lebensprojekte.
Diese Initiativen, die als «Frieden in der Praxis» bezeichnet werden, unterstützen den Wiederaufschwung der lokalen Wirtschaft. Obwohl die Sicherheits- und Wirtschaftslage insbesondere aufgrund des Zusammenbruchs des Friedensabkommens weiterhin äußerst instabil ist, bleiben die Kreise ein wichtiges Instrument, um Frauen zu ermutigen, sich zu engagieren und eine aktive Rolle bei der Förderung des Friedens und beim Wiederaufbau des Landes zu übernehmen .
Weiterführende Informationen:
Webseite DEZA: Mali
What is Peace?
Die Förderung der internationalen Verständigung ist eine Priorität der Schweizer Aussenpolitik, die in diesem Bereich nach wie vor grosses Vertrauen geniesst. Das IC Forum hat gezeigt, dass in Konfliktgebieten wie der Ukraine, Gaza und dem Sudan sowie bei Konflikten, über die in den Medien kaum berichtet wird, ein entschlossenes und realistisches Vorgehen erforderlich ist.
Das IC Forum hob eine weitere Stärke der Schweiz hervor: ihre Fähigkeit, mit einer breiten Palette von Instrumenten flexibel auf hochvolatile Konfliktsituationen zu reagieren und diese wirksam zu kombinieren. Dazu gehören Mediation, Friedensförderung, Entwicklungs- und wirtschaftliche Zusammenarbeit, humanitäre Hilfe und diplomatisches Geschick. Die Schweiz wird ihre Ziele eher erreichen, wenn es ihr gelingt, die aussenpolitischen Instrumente besser zu kombinieren und auf Themen wie Umwelt, Klimawandel, Sicherheit, Menschenrechte, Migration, Ernährungssysteme, Kultur und Friedensförderung auszurichten.
Trotz der schwierigen Lage, beispielsweise in Westafrika, erzielt die Schweiz weiterhin Ergebnisse, indem sie lokale Akteure gleichberechtigt unterstützt, um die Lebensbedingungen der lokalen Bevölkerung durch eine Kombination aus humanitärer Hilfe, Entwicklungsförderung und Friedensförderung zu verbessern. Auch wenn nationale Herausforderungen bestehen bleiben, verbessert die Schweiz die Lage der lokalen Zivilbevölkerung, schafft Perspektiven für eine bessere Zukunft und baut das Vertrauen auf, das für die Aushandlung eines Friedensabkommens erforderlich ist.
Regionale und nationale Sicherheits- und Konfliktverhütungsmechanismen werden in Zukunft zunehmend zum Einsatz kommen und Aufgaben von multidimensionalen UN-Missionen übernehmen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass solche Mechanismen in Zukunft die menschliche Sicherheit gewährleisten und nicht nur militärisch gesicherte Sicherheit. Dies bedeutet nicht nur die Abwesenheit von Krieg, sondern auch, dass die Zivilbevölkerung ihr Potenzial entfalten kann, beispielsweise durch gute Regierungsführung, Demokratie, Menschenrechte und Bildung.
Die Teilnehmer erkannten, dass bestimmte Themen wie natürliche Ressourcen zwar Konflikte auslösen können, aber auch eine friedliche Zusammenarbeit fördern können. Dies kann jedoch nur erreicht werden, wenn Entscheidungen über den Zugang transparent sind und die Gesellschaft insgesamt ein Interesse an den gefundenen Lösungen hat, und diese unterstützt.
weiterverbreitet. Daher besteht eine der größten und schwierigsten Herausforderungen in stark polarisierten Konflikten darin, den Zugang zu faktenbasierten Informationen sicherzustellen. Es ist deshalb von entscheidender Bedeutung für den Frieden, unabhängige Medien zu unterstützen und Factchecking zu ermöglichen.
Weiterführende Informationen:
Take aways IC Forum 2024 (en) (PDF)
Webseite DEZA: Take aways IC Forum 2025
Bergregionen - Adaptation@Altitude
Weiterführende Informationen:
Webseite DEZA: Bergregionen in ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel stärken
Website: Mountain Research Initiative (en)
Website: Adaptation Altitude (en)
Intelligente Stadtentwicklung in Sarajevo
Der digitale Zwilling wird in Sarajevo auch eingesetzt, um die Bevölkerung an der Stadtentwicklung teilhaben zu lassen. Die Stadt führte 2024 verschiedene Bürgerbefragungen zum neuen Stadtplan 2025 - 2040 durch. Mobile Studios zeigten mit Hilfe des Digital Twins, wie sich die Stadt entwickeln könnte, beispielsweise die Grünflächen oder die Verkehrsinfrastruktur. Dazu wurden die Rückmeldungen der Bevölkerung eingeholt und in die Planung einbezogen.
Weiterführende Informationen:
Webseite SECO: Stadtentwicklung und Infrastrukturversorgung
Humanitäre Hilfe bei Umweltkatastrophen
Weiterführende Informationen DEZA:
Vietnam
Amazonas
Simbabwe
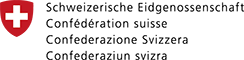




















 Internationale Zusammenarbeit der Schweiz – Jahresbericht 2024
Internationale Zusammenarbeit der Schweiz – Jahresbericht 2024




























































































































































